Becher, Dosen, Besteck: Sollten Sie in Ihrer Küche auf Plastik verzichten?

Plastikboxen, Utensilien, Besteck, Teller, Gläser, Formen, aber auch Haushaltsgeräte – Küchenmaschinen, Wasserkocher, Mixer, Dampfgarer und andere Fleischwölfe. Seit der Synthese der ersten Kunststoffe auf Erdölbasis vor rund hundert Jahren ist Kunststoff aus der Küche nicht mehr wegzudenken.
Doch was enthalten diese Kunststoffe, die zum Zubereiten, Kochen, Aufwärmen oder Aufbewahren von Mahlzeiten verwendet werden? Kunststoffe bestehen nicht nur aus Polymeren (einer chemischen Substanz aus großen Molekülen), „sondern auch aus einer Mischung verschiedener Zusatzstoffe, die dem Kunststoff Eigenschaften verleihen: Flexibilität, Steifigkeit, Feuerbeständigkeit“, erklärt die französische Nationale Agentur für Lebensmittelsicherheit (ANSES).
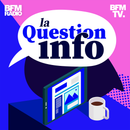
Sollten wir davor auf der Hut sein? „Polymere, die für die Verwendung in Lebensmitteln bestimmt sind, enthalten weniger Zusatzstoffe“, sagte Jean-François Gérard, Professor am INSA Lyon und stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Chemieinstituts des CNRS, gegenüber BFMTV.com.
„Es handelt sich ausschließlich um validierte und zugelassene Polymere, die den Standards, insbesondere innerhalb der Europäischen Union, entsprechen.“
Er räumt jedoch ein, dass die Gefahr nie ganz verschwinden könne. Insbesondere, weil diese Polymere mit der Zeit abgebaut werden. „Wir wissen, dass sie beim Abbau winzige Partikel freisetzen: Mikro- und Nanoplastik, die auch Zusatzstoffe freisetzen“, erklärt Mathilde Body-Malapel, eine auf Immuntoxikologie spezialisierte Forscherin an der Universität Lille, gegenüber BFMTV.com.
Von der ANSES als „potenzielle chemische Verunreinigungen“ eingestufte Zusatzstoffe. „Sie alle können giftig sein“, fügt Mathilde Body-Malapel hinzu, eine Spezialistin für Schadstoffe, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Am bekanntesten sind Bisphenole und Phthalate, die nachweislich endokrine Disruptoren sind. Aber es gibt noch viele andere.
„Die Toxizität einiger der dem Kunststoff zugesetzten chemischen Verbindungen ist bisher kaum erforscht.“
Das Parlamentarische Büro zur Bewertung wissenschaftlicher und technologischer Entscheidungen (OPECST), das sich aus Abgeordneten und Senatoren zusammensetzt, erwähnte in einem im vergangenen November veröffentlichten Bericht über die Auswirkungen von Kunststoffen auf die menschliche Gesundheit insgesamt 4.000 der 16.000 identifizierten chemischen Produkte, die „als gefährlich eingestuft werden können“. Bei der Kontamination durch den Menschen scheint diese erheblich zu sein: „25 % der 14.000 chemischen Produkte, die in Kunststoffmaterialien enthalten sind, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wurden im menschlichen Körper nachgewiesen“, schreibt das Amt.
Der Bericht hebt außerdem die krebserregende, erbgutverändernde und reproduktionstoxische Wirkung dieser Substanzen hervor und verweist auf ihren Zusammenhang mit Genitalfehlbildungen bei Neugeborenen, verzögerter oder beeinträchtigter kognitiver Entwicklung bei Kindern sowie auf ihre Toxizität für bestimmte Organe, Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit. „Die Mängel bei der Bewertung chemischer Substanzen führen dazu, dass ihre Gefährlichkeit unterschätzt wird“, warnen die Autoren.
„Mikroplastik ist in allen menschlichen Organen vorhanden und reichert sich dort an.“
Denn die in einem Kunststoffgegenstand enthaltenen Stoffe können durchaus in die darin enthaltenen Lebensmittel oder Getränke übergehen. Mathilde Body-Malapel spricht von einer „kleinen Degradation“, also einer kleinen Verunreinigung, bei jeder Anwendung. „Es handelt sich zwar um Spuren in minimalen Mengen, die gefunden werden, aber dennoch um Spuren von Nanoplastik.“
„Spuren, mehr Spuren, mehr Spuren, am Ende können potenziell toxische Mengen dabei herauskommen.“
Eine Kontamination, die in „banalen“ Alltagssituationen vorkommen würde, führt Forscherin Mathilde Body-Malapel weiter aus. Ein Plastikbecher in einer Kühlbox voller Eiswürfel, in der Mikrowelle zubereitetes Essen – „sogar in sogenannten mikrowellengeeigneten Behältern“, sagt sie – oder sogar eine Mahlzeit, die in einem Pappbehälter geliefert wird.
Denn im letzteren Fall besteht der Behälter nicht nur aus Pappe. Es ist häufig mit Polymilchsäure – genannt PLA – beschichtet, einem aus Pflanzen gewonnenen Polymer. Und einer Studie des Polytechnischen Instituts Paris zufolge ist die Toxizität dieser Biokunststoffe mit der von gewöhnlichen Kunststoffen aus Erdöl vergleichbar.
„Die Toxizität wird minimiert“, versichert Jean-François Gérard, auch Direktor des CNRS-Programms für Recycling, Wiederverwertbarkeit und Wiederverwendung von Materialien. „Die Zusatzstoffe (in Lebensmittelbehältern, Anm. d. Red.) sollen eine Migration verhindern.“ Obwohl er behauptet, dass diese Migrationen „unter Kontrolle“ bleiben, räumt er ein, dass sich „während der Verwendung, durch Abnutzung, Kratzer, Alterung oder Durchgänge unter dem Scheuerschwamm“ tatsächlich problematische Verbindungen bilden können.
Das Hauptproblem sei jedoch seiner Meinung nach weiterhin der Missbrauch dieser Plastikbehälter. Beispielsweise ein Behälter, der verformt aus der Mikrowelle kommt, eine Schachtel, deren Boden die Farbe der darin enthaltenen Lebensmittel annimmt, eine Antihaftpfanne, die klebrig wird... „Das bedeutet, dass sich die Beschaffenheit des Kunststoffs verändert hat.“
„Wir kennen die Toxizität der einzelnen Substanzen gut, aber je nachdem, wie der Verbraucher sie verwendet, kann sie extrem unterschiedlich sein.“
Einige Situationen stellen jedoch keinen Missbrauch dar. Denn einige Verbindungen dieser Kunststoffe sind öllöslich, andere wasserlöslich. Sie können daher Lebensmittel verunreinigen, ohne dass der Anwender diese Kunststoffe unsachgemäß verwenden muss.
Ein Beweis dafür ist Flaschenwasser: Eine Studie zeigte, dass es durchschnittlich 240.000 nachweisbare Plastikfragmente pro Liter enthält , also Nanoplastik, das so klein ist, dass es in die Organe eindringen kann. Bruchstücke, die insbesondere aus der Flasche selbst stammen würden.
„Wir kennen auch nicht die Cocktaileffekte dieser Zusatzstoffe“, also die Effekte, die sie in Kombination miteinander haben können, betont Mathilde Body-Malapel, die sich insbesondere mit der Wirkung von über die Nahrung aufgenommenem Mikroplastik auf den Darm beschäftigt hat.
Was OPECST außerdem anprangert: „Informationen über ihre Persistenz, Bioakkumulation oder Mobilität sind schwieriger zu finden, da diese Kriterien nicht immer in die staatlichen Bewertungen einfließen.“
Kürzlich wies eine amerikanische Studie auf das Vorhandensein flammhemmender Chemikalien in schwarzen Küchenutensilien aus Kunststoff hin. Eine toxische Präsenz, die durch das Recycling von Kunststoffen aus elektronischen Geräten erklärt werden könnte, die ursprünglich Flammschutzmittel enthielten.
Jean-François Gérard glaubt, dass eine solche Situation in Frankreich unwahrscheinlich sei – Plastik aus elektronischen Geräten könne nicht in lebensmittelechtem Plastik landen, sagt er. Er räumt jedoch ein, dass das Recycling von Kunststoffen noch immer Fragen aufwirft.
BFM TV





