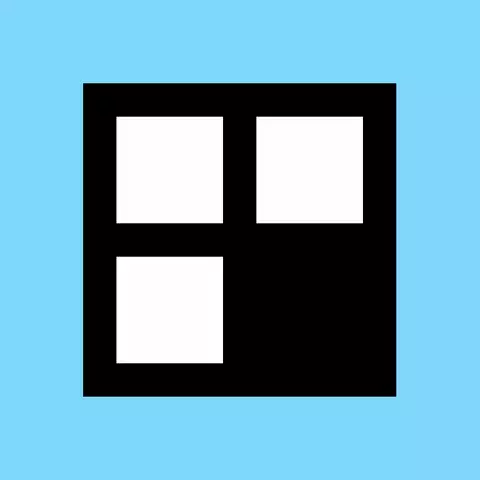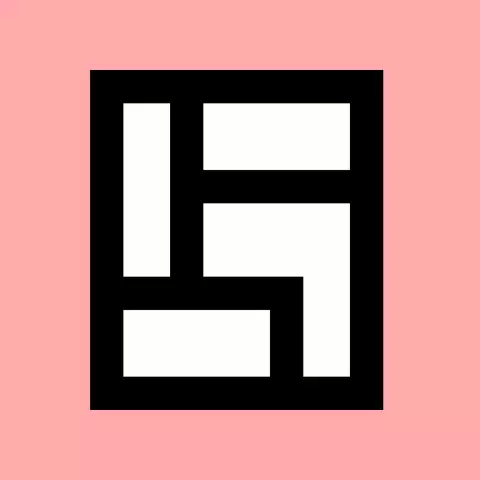On The Run mit John Stifler: Eminem oder Saint-Saëns? Die Playlist für deinen Lauf

Drei Wochen vor dem diesjährigen Boston-Marathon erschien in der Wochenendrubrik des Boston Globe ein Artikel mit dem Titel „Eine Playlist für Ihren langen Lauf am Wochenende“. Drei Wochen vor dem Wettkampf absolvieren Marathonläufer typischerweise einen langen Trainingslauf, vielleicht 29 oder 32 Kilometer. Der Artikel im Globe war der Ansicht, dass ein so langer Lauf sowohl mental als auch körperlich anstrengend sein kann. Sind Sie wirklich bereit, so viel Zeit damit zu verbringen, einen Fuß vor den anderen zu setzen? Könnte Ihnen etwas Musik dabei helfen, in Schwung zu kommen?
Diese Fragen führten zu Interviews mit Spitzenläufern (Bill Rodgers), Athleten anderer Sportarten (dem ehemaligen Bruins-Star Zdeno Chara, der 2024 in Boston in 3:30:52 lief) und Lesern, welche Musik sie besonders motiviert. Mit einer Ausnahme war das Ergebnis eine lange Liste von Popsongs, von Bruce Springsteen über die Dropkick Murphys und Eminem bis hin zu den Bangles. Die Ausnahme war der Pressesprecher des Boston Symphony Orchestra, Matthew Erikson, ein Marathonläufer, der das Finale von Saint-Saëns' Orgelsinfonie bevorzugte.
Aber bringt Musik einen hauptsächlich in Bewegung oder verbessert das Hören von Musik beim Laufen tatsächlich die Intensität und/oder Qualität des Trainings? Der Artikel ging nicht auf diese Frage ein, aber Sportwissenschaftler erforschen sie seit Jahrzehnten.
Die meisten Menschen, die nach Musik suchen, die ihr Training aufwertet, denken sofort an etwas Energiegeladenes, Fröhliches mit gleichmäßigem Rhythmus. Hardrock, Uptempo-Softrock, Disco (ja, ja), Rap. Wissenschaftliche Daten deuten jedoch darauf hin, dass langsame, beruhigende Melodien effektiver sein können.
Forscher der University of Tennessee testeten Probanden auf Laufbändern. Jeder Teilnehmer trug Kopfhörer und hörte laute, mitreißende Musik, langsame, sanfte Musik oder, in der Kontrollgruppe, gar keine Musik. Bei einem bestimmten Tempo berichteten die Probanden, die Hardrock hörten, von einer geringeren wahrgenommenen Anstrengung als diejenigen, die keine Musik hörten. Dasselbe galt für die Gruppe mit sanfter Musik – diese Gruppe konnte allerdings auch länger durchhalten als die beiden anderen Gruppen, bevor sie erschöpft war. Die Forscher schrieben: „Das Hören langsamer, sanfter Musik führte zu einer erhöhten Trainingsausdauer.“
Mit anderen Worten: Matthew Erikson war da einer Sache auf der Spur. Zugegeben, Saint-Saëns' Finale ist nicht leise, aber auch nicht aufdringlich rhythmisch. Es schwillt an wie Wellen. Für einen Läufer könnte es wie eine sehr raffinierte Version der elektronischen Titelmusik des Films „Die Stunde des Siegers“ über die Olympischen Spiele 1924 wirken.
Meine eigene Erfahrung bestätigt diese Eindrücke. Ein Sport- und Fitnessunternehmen schickte mir einmal eine Musikaufnahme, die angeblich genau auf mein Trainingstempo abgestimmt war. „Wir haben die natürlichen Rhythmen des menschlichen Körpers als Grundlage für den Beat verwendet“, schrieben sie.
Ich setzte die Kopfhörer auf, machte mich voller Vorfreude auf einen Probelauf und musste nach fünf Minuten anhalten und die Musik ausschalten. Das Problem war wohl, dass es eine bewusste Anstrengung erforderte, mein Tempo dem Takt anzupassen – etwas, das eigentlich automatisch passieren sollte – und das war ziemlich ablenkend. Ich hatte das Gefühl, als würden mein Körper und die Musik miteinander ringen.
Um einen spektakulären Kontrast zu schaffen, absolvierte ich ein paar Tage später einen 22,5 Kilometer langen Trainingslauf durch hügeliges Gelände und hörte dabei Mozarts „Requiem“. Es war ein herrliches Training, herausfordernd und doch scheinbar mühelos. Ein Grund dafür ist, dass man beim Training und Hören solcher Musik nicht versucht, seine Schritte den Noten anzupassen. Stattdessen macht man das, was Sportwissenschaftler und ausgebildete Sportler als dissoziatives Laufen bezeichnen: Man konzentriert sich auf etwas anderes als die körperliche Anstrengung.
Die meisten Läufer kennen das. Man geht laufen, unterhält sich oder hört Musik, und dann merkt man, dass man schon 40 Minuten gelaufen ist und kaum auf die Zeit geachtet hat. Das Gegenteil ist das assoziative Laufen, bei dem man sich auf die Übung selbst konzentriert. Spitzenläufer laufen typischerweise assoziativ. Das gilt auch für viele Durchschnittsläufer, insbesondere bei einem zeitgesteuerten Training oder einem Rennen.
Noch interessanter finde ich jedoch, dass einem, wenn man keine Kopfhörer oder Ohrhörer trägt und eine Playlist hört, unaufgefordert eine Melodie durch den Kopf geht. Dabei merkt man vielleicht, dass die Musik perfekt zu seinem Tempo passt. Wahrscheinlich liegt das daran, dass das Gehirn automatisch ein Metronom einstellt, um das Tempo der Melodie an das eigene Tempo anzupassen. Bei mir ist es mal Bachs 3. Brandenburgisches Konzert, mal Elton John. Oder beim Langlaufen „Ticket to Ride“ von den Beatles. Schaut euch „Help!“ noch einmal an, dann wisst ihr, warum.
Unabhängig von technischen Analysen motiviert Sie wahrscheinlich Musik, die Ihnen gefällt. Sie mag zwar nicht Ihre Ausdauer steigern, aber wenn sie Sie dazu bringt, sich zu bewegen, warum sollten Sie dann widersprechen?
John Stifler lehrte Schreiben und Wirtschaftswissenschaften an der University of Massachusetts und schrieb viel für Zeitschriften und Zeitungen. Er ist erreichbar unter [email protected].Daily Hampshire Gazette