Wenn wissenschaftliche Integrität zur Waffe wird

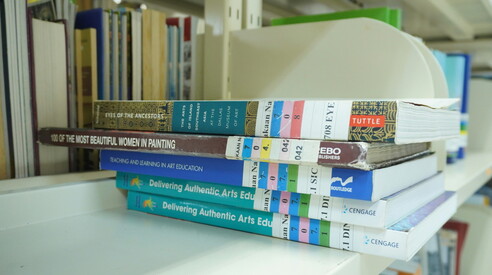
Foto von Saung Digital auf Unsplash
Schlechte Wissenschaftler
Die wissenschaftliche Selbstkorrektur, ein Eckpfeiler der Glaubwürdigkeit der Forschung, wird nun verzerrt und dazu missbraucht, das gesamte System zu delegitimieren. Zwischen bürokratischen Verzögerungen und politischer Manipulation sind dringend Reformen nötig, um Whistleblower zu schützen und das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken.
Schon seit einiger Zeit dient der Ruf nach Integrität in der wissenschaftlichen Forschung nicht mehr dazu, deren Glaubwürdigkeit zu stärken, sondern ist zu einer Waffe geworden, um sie anzugreifen , wie nun auch Nature anprangert. Experten, die jahrelang Bildduplikate, gefälschte Daten und gefälschte Peer-Reviews identifiziert haben, mit dem einzigen Ziel, die Literatur zu stärken, sehen sich nun damit konfrontiert, ihre Ergebnisse für das Argument instrumentalisiert zu sehen, die gesamte Wissenschaft sei verdorben. Die aufsehenerregendsten Fälle von Rücknahmen und Betrug – jene, die zur Entdeckung, Korrektur und Rücknahme der Ergebnisse ganzer betrügerischer Labore führten – werden als Beweis für deren Verdorbenheit herangezogen, nicht als Beispiel für die Fähigkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft, sich zu reformieren.
Was diese Ausbeutung ermöglicht hat, ist nicht so sehr die Entdeckung der Mängel selbst, sondern die Langsamkeit und Ineffektivität des Selbstkorrekturprozesses. Nachdem ein möglicher Integritätsmangel einer Zeitschrift oder Institution gemeldet wurde, dauern die Überprüfungen normalerweise jahrelang, und interne Ausschüsse sind vor Angst vor Skandalen wie gelähmt . Oftmals verharren Berichte in der bürokratischen Schwebe, ohne klare Fristen und ohne echten Schutz für diejenigen, die sich zu Wort melden, bis ein möglicher Widerruf oder eine Reaktion der betreffenden Institution – falls es dazu kommt – den Anschein eines endlosen Prozesses erweckt.
Zu dieser Langsamkeit kommt die Angst vor Aufdeckung hinzu. Ich erinnere mich noch gut an die Vorwürfe, die vor fünfzehn Jahren gegen mich erhoben wurden, als ich argumentierte, es sei notwendig, die Mängel in veröffentlichten Artikeln aufzudecken und zu korrigieren und nicht nur „positive“ Ergebnisse zu diskutieren. Damals wurde mir gesagt, dass die Berichterstattung das „Vertrauen“ in die Wissenschaft „untergraben“ würde; ich wurde isoliert, wegen meiner Arbeit angegriffen, mit Strafverfolgung bedroht und anderweitig – ich fürchte für immer – von der Akademie als „unkontrollierbar“ stigmatisiert. Daher haben und werden viele Kollegen lieber wegschauen und die Dinge auf sich beruhen lassen, aus Angst vor negativen Auswirkungen auf ihre Karriere oder laufende Projekte, es sei denn, sie wenden sich an mich oder einige andere Kollegen, die meine Arbeit machen. Dieses Schweigen und diese Angst haben ein Klima der Komplizenschaft geschürt: Diejenigen, die hätten eingreifen können, haben sich dagegen entschieden und einen Apparat intakt gelassen, der Transparenz fordert, sich aber weigert, die Konsequenzen der Umsetzung dieses Aufrufs in die Tat zu akzeptieren.
Aufgrund dieser Komplizenschaft ist die Selbstkorrektur der Wissenschaft zu einem Hindernislauf geworden: Berichte gären in internen Ausschüssen, Rücknahmen werden von Zeitschriften verzögert, vertrauliche Dokumente werden nur von wenigen gelesen und selbst schwerwiegende Integritätsprobleme werden allgemein hingenommen .
Gleichzeitig wächst der Widerstand wissenschaftlicher Zeitschriften gegen die umgehende Korrektur von Fehlern: Einerseits sind Reputationsverluste und sinkende Zitationen die Ursache – beschleunigt durch eine kürzlich erfolgte Änderung der Impact-Factor-Berechnung, die Zeitschriften mit zahlreichen Rückzügen bestraft – und andererseits die Tatsache, dass Redaktionen oft mit Klagedrohungen von Institutionen oder Forschern, die in Betrug verwickelt sind, allein gelassen werden. Diese Situation macht es noch unwahrscheinlicher, dass ein fehlerhafter Artikel schnell korrigiert wird, was das Potenzial für politische Instrumentalisierung vervielfacht.
An diesem Punkt setzt in den USA die politische Axt an: Ein Dekret verspricht zwar, die Wissenschaft wieder auf den höchsten Standard zu bringen, gibt den politischen Entscheidungsträgern aber tatsächlich die Macht zu bestimmen, was gültige Wissenschaft ist und was nicht . Mit diesem Instrument können Regierungsvertreter Änderungen der Integritätsrichtlinien fordern, um den Schutz „alternativer wissenschaftlicher Meinungen“ zu rechtfertigen oder für ihre eigenen Zwecke zu definieren, welche Forschung Unterstützung verdient.
In diesem Zusammenhang haben Persönlichkeiten wie Robert F. Kennedy Jr. eine symbolische Rolle eingenommen. Während seiner Anhörung zum Gesundheitsminister berief er sich auf den Widerruf einer Reihe von Alzheimer-Studien nach Untersuchungen, an denen ich selbst mitgewirkt hatte. Damit argumentierte er, dass Regierungsbehörden wie die NIH und die FDA sowie die sie unterstützende wissenschaftliche Gemeinschaft zwanzig Jahre lang eine „betrügerische Hypothese“ über den Ursprung der Krankheit verbreitet und das Fehlen einer Heilung direkt mit interner „Korruption“ in Verbindung gebracht hätten. Seine Aussagen lenkten die Debatte von den stichhaltigen Beweisen für die Rolle des Amyloid-Proteins bei der Entstehung von Alzheimer ab und lenkten die Aufmerksamkeit auf die Vorstellung, dass der gesamte Bundeshaushalt durch versteckte Absichten manipuliert worden sei. Die Sorge um die wissenschaftliche Integrität der „Forscher“ ist offensichtlich: Während sie weiterhin mit dem Finger auf fehlerhafte Arbeiten zeigen, um die Wissenschaft von innen heraus zu verbessern, sehen sie das wachsende Risiko, dass ihre Bemühungen als Freibrief zur Zerstörung oder Behinderung ganzer Fachgebiete interpretiert und allgemein als „Beweis gegen“ die Wissenschaft verwendet werden.
Wir müssen diese Verzerrung neu ausräumen. Wir brauchen einen selbstkorrigierenden Mechanismus, der flexibel, transparent und bei Bedarf auch angemessen strafend ist. Universitäten müssen unabhängige Meldestellen mit klaren Regeln, garantierter Anonymität und klaren Reaktionszeiten einrichten: ein System, in dem jeder, der einen methodischen Fehler entdeckt, diesen melden kann, ohne sich auf einen bürokratischen Kampf einstellen zu müssen. In Italien gibt es ein Beispiel: die vor langer Zeit vom CNR eingerichtete Kommission, mit der ich direkt zusammenarbeite. Dieses Modell hat sich vielfach als besser erwiesen als die schwachen und inkonsistenten Versuche der Universitäten.
Zeitschriften müssen optimierte Korrektur- und Rücknahmeverfahren einführen, begleitet von ehrlichen, nicht-inquisitorischen Erklärungen, damit die Leser verstehen, was passiert ist, ohne dass Verschwörungstheorien aufkommen. Sie müssen dazu verpflichtet werden, Fälle zu melden, in denen sie keine Korrekturen vornehmen (selbst wenn Autoren Rücknahmen verlangen), und bei der Auswahl der Zeitschriften, denen sie ihre Manuskripte zur Veröffentlichung vorlegen, entsprechend zu handeln. Natürlich ist es an der Zeit zu fordern, dass die Redaktionen von den Unternehmen, denen die Zeitschrift gehört, geschützt werden, ohne dass sie eigene Ressourcen einsetzen und direkten Bedrohungen ausgesetzt sein müssen, wie es allzu oft geschieht, wenn sich Betrüger energisch verteidigen.
Öffentliche Geldgeber müssen ihre Auszahlungen an die wirksame Umsetzung institutioneller Transparenzrichtlinien knüpfen, die die Autonomie der Forscher schützen und gleichzeitig die Einhaltung der geforderten Standards durch Universitäten und Labore sicherstellen. Dies gilt insbesondere für Rücknahmen und Korrekturen, die auf Anfrage der Veröffentlichungsautoren als lobenswert und nicht als stigmatisierend gewertet werden müssen (vorausgesetzt natürlich, es treten keine weiteren Probleme auf, und vor allem muss zwischen den Meldenden und den Betrugsverursachern unterschieden werden).
Nur wenn wir der Selbstkorrektur der Wissenschaft wieder ihren Stellenwert als notwendiger Schritt verleihen – und nicht als Skandal, den es zu vertuschen gilt –, können wir politischen Demagogen den Stoff für ihre wissenschaftsfeindliche Offensive entziehen . Selbstkorrektur muss wieder als erkenntnistheoretischer Wettbewerbsvorteil wahrgenommen werden, nicht als zu vermeidendes Risiko: Denn nur ein System, das keine Angst davor hat, seine eigenen Schwächen offenzulegen, ist fähig zum Fortschritt. Hier muss die wahre Verteidigung der Forschung wieder ansetzen: nicht durch die Wahrung des Images dieses oder jenes Forschers, sondern durch die Etablierung einer echten Beweiskultur, in der das Aufdecken der Schwachstellen bessere Fortschritte ermöglicht.
Mehr zu diesen Themen:
ilmanifesto




