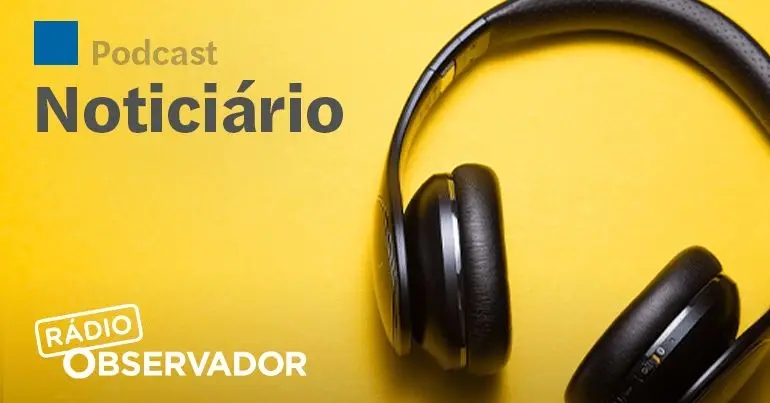Die Schusswaffe

Die gewaltigen Waldbrände in den ländlichen Gebieten sind zurück und mit ihnen die endlosen Tiraden der Regierung, der Opposition, der lokalen Behörden, Generalisten, Experten und Kolumnisten, derjenigen, die glauben, Bescheid zu wissen, und auch derjenigen, die es nicht wissen, aber sonst nichts zu tun haben.
Ohne auf Chronologien Rücksicht zu nehmen oder den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, erinnere ich mich an Eduardo Cabrita, der Maria Lúcia Amaral beschuldigte, die Bedeutung von Flugzeugen nicht zu verstehen, an António Nunes, der betonte, dass Feuerwehrleute die Einsätze leiten sollten, an Mariana Leitão, die die Desorganisation der Brandbekämpfungsressourcen kritisierte, an Tiago Oliveira, der der Öffentlichkeit verantwortungsvolles Verhalten empfahl, an André Ventura, der gegen Brandstifter schimpfte, an José Miguel Cardoso Pereira, der die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte analysierte Brandbekämpfung, António José Seguro fordert einen Generationenpakt, Luís Montenegro erinnert an die Endlichkeit der Ressourcen zur Brandbekämpfung, Henrique Pereira dos Santos weist auf die mangelnde Waldbewirtschaftung hin, José Luís Carneiro gratuliert sich dazu, dass die Regierung den Empfehlungen seiner Partei folgt, die klugen Köpfe von Marinhais erwarten das Feuerwerk, um den bald in Kraft tretenden Alarm zu umgehen, und Ricardo Trigo erklärt die extremen Wetterbedingungen gewesen Auswirkungen auf das Land.
Die Vielfalt der Meinungen und die Vielzahl der diskutierten Themen erfordern eine Begründung, d. h. einen Rahmen, der die Argumentation leitet. Ich schlage eine einfache Methode vor, bei der ein großer Waldbrand mit den Auswirkungen eines Schusses – sozusagen einer „Schusswaffe“ – verglichen wird. Damit ein Schuss abgegeben werden kann, muss der Abzug gedrückt, hochwertiges Schießpulver verwendet, eine Kugel verwendet werden, die Schaden anrichten kann, und nicht zuletzt muss eine geeignete Waffe vorhanden sein.
Im vorgeschlagenen konzeptionellen Rahmen beziehen sich alle Diskussionen über Hierarchie, Kompetenz und Organisation der Streitkräfte sowie die umgesetzte Strategie und die Angemessenheit der Ressourcen ausschließlich auf die Abschwächung der Auswirkungen des Schusswaffengebrauchs, nicht auf den Schuss selbst. Dies sind natürlich sehr wichtige Aspekte, die nicht ignoriert werden dürfen, wenn ein Schusswaffengebrauch stattfindet, sondern auch danach. Der Glaube, die durch den Schusswaffengebrauch entstehenden Probleme könnten durch die Erhöhung der Anzahl und Einsatzkapazität der Interventionsressourcen (nach dem Schusswaffengebrauch) gelöst werden, ist ein offensichtlicher Irrtum, den leider immer noch viele begehen.
Da das Betätigen des Abzugs die unmittelbare Ursache für den Schuss ist, ist es wichtig zu wissen, ob die „Schusswaffe“ aus natürlichen Gründen abgefeuert wurde, etwa durch einen Blitzeinschlag bei einem trockenen Gewitter, durch einen auf menschliches Handeln zurückzuführenden Unfall, etwa einen Funken, der durch den Kontakt einer Stromleitung mit Baumkronen entsteht, oder durch direktes menschliches Handeln, sei es fahrlässig, etwa durch Feuer, den Einsatz von Maschinen oder das Abfeuern von Feuerwerkskörpern, oder kriminell. In diesem Zusammenhang sind Aufforderungen an die Bevölkerung, sich zündungsvorbeugend zu verhalten, erhöhte Wachsamkeit Tag und Nacht und die Ausrufung von Alarmstufen für das gesamte Gebiet sicherlich angemessene Maßnahmen, aber sie gehen nicht auf das Kernproblem ein, nämlich die Verhinderung verheerender Folgen eines Schusses, sollte er doch einmal erfolgen.
Hinzu kommt der Aspekt der Schießpulverqualität, die bei Feuerwaffen direkt mit den atmosphärischen Bedingungen zusammenhängt, nämlich hohen Temperaturen, niedriger Luftfeuchtigkeit und starkem Wind, insbesondere in Verbindung mit einer langen Periode ohne Niederschlag. Obwohl die Meteorologie nicht kontrollierbar ist, ermöglichen uns Vorhersagemodelle, die Wetterentwicklung immer genauer zu verstehen und so die Qualität des Schießpulvers vorherzusagen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch Trockenpulver abgefeuert werden kann, d. h. ohne Kugeln im Lauf. Dies ist beispielsweise in der Sahara der Fall, wo trotz der hervorragenden pyrometeorologischen Bedingungen, die hochwertiges Schießpulver garantieren, nichts verbrennt.
Die Zerstörungskraft eines Schusses hängt in der Tat stark von den spezifischen Eigenschaften des Geschosses ab, die wiederum von Landschaftsmerkmalen wie Topographie, Vegetationsmuster, Vegetationsart und -stress sowie vor allem von der Qualität der Bewirtschaftung bestimmt werden. Kontrollierte Brandbekämpfung, Rodungen, der Bau von Brandschneisen, die Ansiedlung von Ziegen und Schafen sowie Sensibilisierungskampagnen sind nur einige der zahlreichen Maßnahmen zur Reduzierung der Zerstörungskraft von Geschossen.
Der wirklich entscheidende Aspekt ist jedoch die Existenz der Waffe selbst. Ohne Waffe macht es keinen Sinn, über Schüsse, Schießpulver oder Kugeln zu sprechen. Daher ist eine wirksame Kontrolle, die die Verbreitung von Waffen einschränkt, der einzige wirklich wirksame Weg, die durch Schießereien entstehenden Probleme zu verringern. Im Fall von „Schusswaffen“ wird diese Kontrolle durch die Raumplanung erreicht. Dies ist jedoch eine sehr kostspielige Maßnahme, die sich über einen langen Zeitraum erstreckt und deren Ergebnisse nicht unmittelbar spürbar sind – Eigenschaften, die es der heutigen egozentrischen und auf das Unmittelbare fokussierten Gesellschaft schwer machen, sie zu akzeptieren. In diesem Sinne wäre ein potenziell wirksamer Weg, die Bürger zu mobilisieren, sie davon zu überzeugen, dass das Territorium ein „gemeinsamer Teil“ des Landes ist und dass, wie bei einer Eigentumswohnung, Verpflichtungen gegenüber den gemeinschaftlichen Teilen (sei es ein Fundament oder eine Dachterrasse) bestehen, auch wenn wir nicht direkt davon profitieren, da sie für die Erhaltung des baulichen Ganzen unerlässlich sind.
Ein solcher Vorschlag wirft natürlich die Frage auf, ob das Wissen, das eine effiziente Bewirtschaftung der Gemeinschaftsflächen ermöglicht, bereits vorhanden ist. Dieses Wissen ist tatsächlich vorhanden, und jeder von uns kann sich den Nationalen Plan für integriertes ländliches Brandschutzmanagement 20-30 auf Grundlage der Entschließung des Ministerrats Nr. 45-A/2020 vom 16. Juni 2020 besorgen. Das Problem ist daher ausschließlich die Umsetzung und daher eminent politisch. Wie jemand vor einigen Tagen treffend feststellte: „Es wurden Fortschritte bei der Brandbekämpfung erzielt, aber es mangelt an Schulungen, weil wir über zu viele Informationen verfügen.“ Ich stimme dieser Aussage voll und ganz zu. Vor allem, weil ich sie selbst getroffen habe.
observador