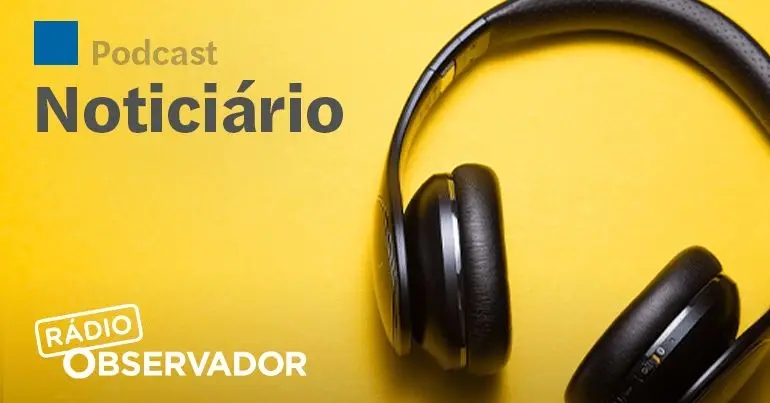NULL Ökologie, viel Ideologie: Die Maske ist endgültig gefallen

Seit seiner Gründung wurde ZERO ausführlich in den Nachrichten und Kommentaren erwähnt und von den Medien stets als Bastion ökologischer Rationalität, als Säule des Umweltwissens und als Quelle technischen, sachlichen und objektiven Wissens auf der Grundlage überprüfbarer Daten dargestellt. Nun hat ZERO – in einer bewundernswerten Geste der Transparenz und Direktheit – endlich sein Coming-out bekannt und reinen Tisch gemacht und seinen als Umweltschutz getarnten Antikapitalismus offengelegt. Ich beziehe mich auf die hier verfügbare Erklärung , in der es eindeutig heißt, dass es ZERO um „private Profite“, die „auf öffentliche Kosten subventioniert“ werden, und um „große agroindustrielle Betriebe“ geht. Nichts davon ist Umweltschutz; alles ist Antikapitalismus. ZERO übt keine fundierte technische Kritik, sondern prangert „ungerechtfertigte private Profite“ durch „große Konzerne“ an, die öffentliches Wasser „ausnutzen“, als wäre das Problem nicht nachhaltiges Wassermanagement, sondern die Existenz von Privatkapital im Agrarsektor.
Diese Rhetorik baut keine Brücken zwischen Ökonomie und Ökologie, sondern Mauern. Es ist eine Diskussion, die nur scheinbar ökologisch sinnvoll ist, da sie Großbauern verteufelt, den Strukturwandel zum Besseren, den der Alqueva-Staudamm dem Alentejo gebracht hat – mit mehr Arbeitsplätzen, mehr Exporten, mehr jungen Menschen und mehr Artenvielfalt – völlig ignoriert und suggeriert, das einzig legitime Modell sei das des kleinen, im Regenfeldbau arbeitenden Produzenten, romantisiert, geflickt und geflickt, vielleicht ehrenhaft, aber meist zum bloßen Überleben verdammt…
Was ZERO in der Praxis beabsichtigt (lesen Sie die Erklärung!), ist die Begrenzung des landwirtschaftlichen Wachstums durch die Errichtung künstlicher wirtschaftlicher Barrieren – ein klassischer Mechanismus antikapitalistischer Bewegungen: die Preispolitik von Produktionsfaktoren, in diesem Fall Wasser, soll Marktaktivitäten hemmen. Die Umwelt wird zum Argument, doch das Ziel scheint etwas anderes zu sein: das Wirtschaftsmodell, das dem Alentejo Stagnation, Wüstenbildung und Verwahrlosung entgehen ließ. Für ZERO sollte Alqueva gar nicht erst existieren, nicht der Umwelt zuliebe, sondern um Entwicklung, Wohlstand und Fortschritt zu verhindern.
Der Vorwurf an die Regierung, sie würde „private Profite“ mit öffentlichen Mitteln subventionieren, geht in dieser Rhetorik weniger von einer ökologischen Vision als vielmehr von einem antikapitalistischen Impuls aus: Das Problem ist nicht mehr die Nutzung des Wassers, sondern die Tatsache, dass es Menschen gibt, die wirtschaftlich davon profitieren.
In ZEROs Narrativ wird die Großlandwirtschaft als Raubtier behandelt, private Investitionen als suspekt angesehen und Wirtschaftswachstum als Bedrohung an sich betrachtet. Im Wesentlichen lässt sich aus der Erklärung – und dem Vorschlag von ZERO – eine bewusste Begrenzung des Produktionsumfangs herauslesen: nicht zum Schutz der Umwelt, sondern um den Profit zu bestrafen. Das ist keine Zukunftsvision, sondern eine Absage an Entwicklung.
Was wäre, wenn diese Ablehnung vor 25 Jahren geherrscht hätte? Im Alentejo hätte es Alqueva nicht gegeben, und Bewässerung wäre nie entstanden. Die Landwirtschaft wäre in Trockenheit, Klimaunsicherheit und geringer Produktivität gefangen geblieben. Traditionelle Olivenhaine, spärliche Weiden und etwas Weizen hätten eine ausgelaugte Landschaft ohne Vögel, kleine Säugetiere oder einheimische Arten geschaffen – ohne Wasser überlebt wenig oder nichts. Die Produktivität wäre niedrig, landwirtschaftliche Investitionen wären marginal und Arbeitsplätze wären eine bloße Fata Morgana in einer idyllischen, aber unproduktiven Landschaft.
Echter Umweltschutz muss anspruchsvoll sein – das muss er, und Landwirte, die wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel, wissen das nur zu gut –, aber er muss auch konstruktiv sein. Er muss Lösungen vorschlagen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten basieren, und nicht auf unangemessenen Reaktionen, die auf einer moralistischen Sicht der Wirtschaft beruhen. Er muss Verschwendung bekämpfen, Wassereffizienz fördern und Transparenz bei der Ressourcennutzung fordern – darf aber nicht der Versuchung erliegen, Wasser als ideologische Waffe gegen diejenigen einzusetzen, die investieren, Arbeitsplätze schaffen und das Wachstum im Landesinneren fördern. Und wenn wir schon dabei sind, widerstehen wir der Versuchung, das gesegnete Wasser der Alqueva zu kritisieren, das so viel Artenvielfalt angezogen und erhalten hat und so viel zur Bekämpfung der Wüstenbildung beigetragen hat, indem es den Untergang des Gebiets verhindert hat.
Es gibt Spielraum für ein Gleichgewicht zwischen Nachhaltigkeit und Entwicklung, und es gibt Argumente, die für ZERO sinnvoll sein könnten, von denen sich keines in der oben genannten Erklärung findet. Um dies zu erreichen, darf die Umweltdebatte jedoch nicht von Agenden vereinnahmt werden, die unter dem Deckmantel der Ökologie ein tiefes Misstrauen gegenüber privaten Unternehmen verbergen. Wenn Sie das nächste Mal ZERO hören, werden Sie es nur dann akzeptieren, wenn Sie es wollen, denn Sie haben es mit einem Antikapitalisten zu tun, der sich als Umweltschützer tarnt.
observador