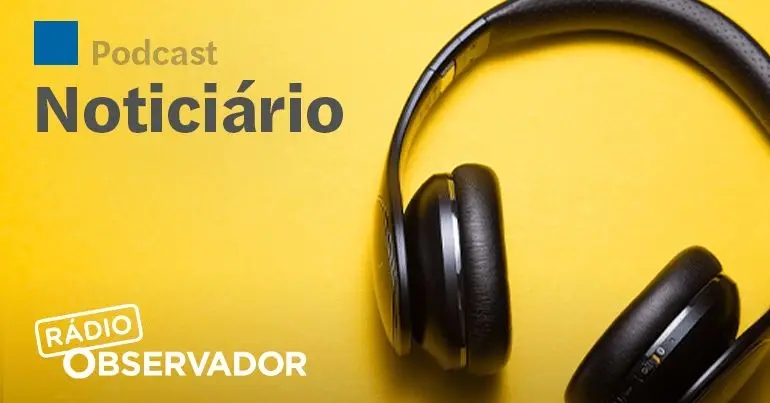Städte der Zukunft und kollaboratives Management

Auf einer kürzlich in Aveiro abgehaltenen Konferenz wies João Ferrão [ein Geograph an der Universität Lissabon] im Zusammenhang mit dem Konzept der Nähe auf ein Risiko hin: Nähe kann manchmal irreführend sein. Zwei Menschen können jahrelang im selben Gebäude wohnen, ohne jemals miteinander gesprochen zu haben. Die von uns gewünschte Nähe ist relationaler Natur und hat eine emotionale, kognitive und erfahrungsbasierte Dimension. Sie fördert Fürsorge, gemeinsames Interesse und Empathie, die wir während der Pandemie seltsamerweise besonders stark gespürt haben.
Für den Forscher war die Pandemie ein hervorragendes Labor. Ich bin überzeugt, dass wir dieses Wissen nicht verloren haben, es ist nur nicht aktiviert. Es muss reaktiviert werden, vor dem Hintergrund der Zeiten, in denen wir gezwungen waren, uns zu organisieren und zusammenzuarbeiten, um Antworten zum Wohle der Allgemeinheit zu finden.
Das Gemeinwohl, über das viele vielleicht die Achseln zucken oder die Augenbrauen hochziehen, weil sie es für ein vielleicht zu abstraktes oder weit entferntes Konzept halten, ist es laut José Carlos Mota nicht.
Es geht darum, sich selbst, jeden von uns, zu fragen, was wir gemeinsam tun können, um Wirkung zu erzielen und das Leben aller zu verbessern. Das ist keine Utopie, aber es erfordert mehr politischen Willen auf lokaler und nationaler Ebene, mehr technische Vermittlung und Schulungen zur Unterstützung partizipativer Prozesse sowie eine koordinierte Zusammenarbeit der verschiedenen Regierungsebenen – der lokalen, nationalen und europäischen.
Eine bessere Zukunft für Städte – und das ist das Markenzeichen von UNHABITAT – hängt gemäß den Richtlinien der Vereinten Nationen für Stadt- und Raumplanung weitgehend von ihrer Fähigkeit ab, Modelle einer gemeinsamen, partizipativen und kollaborativen Governance zu übernehmen, wie sie von José Carlos Mota vorgeschlagen werden, der auf die Städte Barcelona, Bologna und, in anderer Weise, Paris als Referenzen und Inspiration verweist.
Bologna, so der Forscher, verfügt über eine Agentur für städtische Innovation, Bürgerlabore und einen sogenannten Gemeinschaftspakt. Dieser sei durch italienische Gesetze möglich geworden, die den Bürgern die Verwaltung öffentlicher Gemeinschaftsgüter übertragen.
Barcelona sei „ein Beispiel für partizipative Nachbarschaftsdynamik“ und verfüge über ein innovatives Modell partizipativer Stadtplanung, bei dem die Bürger mithilfe einer Online-Plattform an Entscheidungen über öffentliche Räume, Mobilität, Kultur und Infrastruktur beteiligt werden. Auf Basis von Online-Abstimmungen und permanenten digitalen Konsultationen können sie Projekte für ihre Nachbarschaften vorschlagen; Stimmen Sie über Vorschläge anderer Einwohner ab, überwachen Sie den Fortschritt öffentlicher Arbeiten und Budgets oder nehmen Sie an virtuellen Foren, Konsultationen und Debatten teil. Die Vorschläge mit der größten Unterstützung werden in den Bürgerhaushalt der Stadt integriert und erhalten ein Budget sowie einen Umsetzungsplan, sodass die Stadtplanung auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen kann.
Paris hingegen hat die Dynamik von Nahstädten und ein neues Stadtmodell entwickelt, das auf dem Konzept der 15-Minuten-Städte basiert. Obwohl José Carlos Mota kein Fan des Konzepts ist, glaubt er, dass es „das Stadtmodell im Hinblick auf seine Bürger aus städtebaulicher Sicht überdenkt und neu organisiert“.
Sie, die Bürger, müssen im Mittelpunkt der Städte stehen – und mit dem Zentrum ist hier der physische, symbolische und entscheidungstragende Ort gemeint.
observador