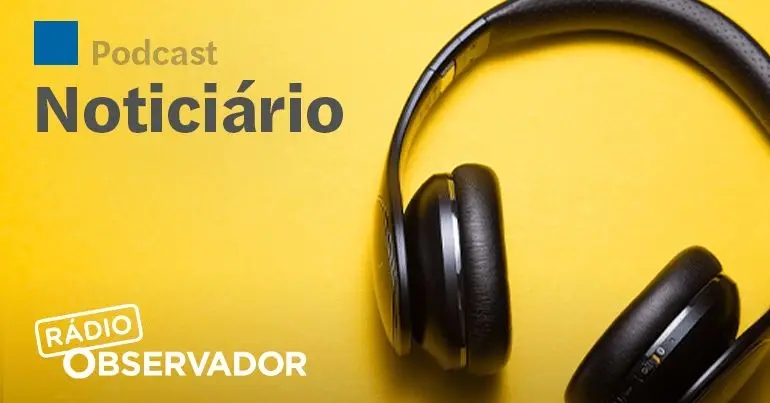Teresa Torga: Die Geschichte der Frau hinter dem Lied

Eine Frau beschloss, sich nackt auszuziehen und an der Kreuzung der Avenida Miguel Bombarda und Avenida 5 de Outubro in Lissabon zu tanzen. Es war vier Uhr nachmittags, wir schrieben das Jahr 1975 und das Land sprühte vor Freude über die neu gewonnene Freiheit.
„Ex-Fado-Sänger nackt mitten in der Stadt“, lautete der Titel der Kolumne des Journalisten Rogério Rodrigues (1947–2019), die am 7. Mai 1975 in Diário de Lisboa erschien. Aus dieser Geste entstand am nächsten Tag der journalistische Text und später ein Lied von José Afonso, Teresa Torga. Doch wer war schließlich die „ Frau in der Demokratie “, die auch die Künstlerin der Revolution als „ kein Wohnzimmerbildschirm “ besang?
In der Chronik hieß es, der Protagonist der Episode habe während der Pausen einer psychiatrischen Behandlung im Júlio Matos-Krankenhaus nackt getanzt. Der Journalist erzählt die Geschichte einer Frau, „deren Name unbekannt war“, und die am Tag zuvor um vier Uhr nachmittags einen „kompletten Striptease“ hingelegt hatte.
„Sichtlich überrascht gingen einige Zuschauer der Szene, was in den Straßen Lissabons ungewöhnlich ist, auf die Frau zu, um sie vor den Blicken der Passanten und Stehenden zu schützen und sie zu überreden, sich anzuziehen und den Ort zu verlassen“ , berichtet er. Mitten im Chaos taucht der Reporter António Capela auf und beginnt zu filmen. Die Einheimischen, empört über diesen ihrer Ansicht nach ‚moralischen Affront‘, greifen ihn an, beleidigen ihn, schubsen ihn und greifen ihn an. Nur das Eingreifen des Besitzers der nahegelegenen Drogerie verhindert, dass seine Kamera zerstört wird. Er wird gezwungen, den Film herauszugeben, der jedoch noch am selben Ort zerstört wird. Es kommt zu zahlreichen Protesten, und der Fotojournalist António Capela beschließt, vom Ort des Geschehens zu verschwinden.

▲ „Ehemaliger Fado-Sänger nackt mitten in der Stadt“, titelte Rogério Rodrigues‘ Kolumne in Diário de Lisboa am 7. Mai 1975
Weiter heißt es: „Einer der Anwesenden ruft die 115 an, die erst eine halbe Stunde später eintrifft. Inzwischen wurde die Frau (noch immer nackt) auf den Armen zu einem Gebäude getragen, an dessen Tür ein Portier steht. Sie war bereits angezogen und blickte apathisch auf die Menschen um sie herum .“ „ Sie sagten mir, ihr Name sei Maria Teresa. ‚Ich bin nicht Maria. Ich bin nicht Teresa. Ich habe viele Namen.‘ Ihre Lippen waren verschrumpelt und sie lehnte das ihr angebotene Glas Wasser ab.“ „ Wer hat sich gestern um 16 Uhr in der Öffentlichkeit ausgezogen? “, fragt der Journalist und erzählt dann die inzwischen aufgeklärte Lebensgeschichte einer 41-jährigen Frau, geschieden, Revueschauspielerin, zunächst Revuegirl, Auswanderin nach Brasilien, Fado-Sängerin, zwischen zwei Behandlungen bei Júlio de Matos. „Sie verwendet den Namen Teresa Torga, weil es eine Schriftstellerin gibt, die sich so nennt“ und sie sehr gern lese, erklärt eine Nachbarin. Als der Reporter sie das letzte Mal sah, folgte sie ihm in einem Polizeiauto zur Polizeiwache Matadouro.
Ein Jahr später erscheint das Lied, das die Geschichte verewigt:
Im Zentrum der Avenue An der Kreuzung der Straße Um Punkt vier Uhr verloren Eine nackte Frau tanzte
Die Leute, die die Szene sahen Er rannte zu ihr Um sie anzukleiden Aber António Capela erscheint
Die bärtige Frau ausnutzen Denken Sie nur daran, sie zu fotografieren Frauen in der Demokratie Es ist kein Wohnzimmerbildschirm
Sie sagen, ihr Name sei Teresa Ihr Name ist Teresa Torga Ändern Sie die Abholung in Benfica Ertrage die Gang an der Bar
Zimmer im Haus vermieten Aber es war schon der erste Stern Jetzt ist sie gezwungenermaßen Model Lassen Sie sich von Antonio Capela erzählen
Teresa Torga Im Ofen besiegt Es gibt keine Flagge ohne Kampf Es gibt keinen Kampf ohne Schlacht“ — „Teresa Torga“, aus dem Album „With my Little Clogs“ (1976) —
José Afonso sagte in Interviews immer, er sei durch einen Zeitungsartikel zu dem Lied inspiriert worden, aber der Text wurde erst 2006 durch das Buch Os loucos dias do PREC von Adelino Gomes und José Pedro Castanheira (Expresso/Público, 2006) bekannt. Die Chronik bestätigte den Inhalt des Liedes und gab weitere Hinweise zu dieser Frau.
Maria Teresa Gomes Baptista wurde am 25. November 1932 in der Pfarrei São Sebastião da Pedreira in Lissabon als Tochter von José Baptista und Maria Felicidade Gomes geboren.

▲ Es sind nur wenige Fotos von Teresa Torga bekannt. Dieses hier wurde in den 1960er Jahren im Plateia-Magazin veröffentlicht und Anfang des Jahres zur Werbung für das Theaterstück „Kein Joghurt für die Toten“ verwendet.
Beruflich offenbarte er sich 1952 durch Ricardo Covões, Leiter des Coliseu dos Recreios in der Hauptstadt, der ihm einen Eintrag in der Zeitschrift Lisboa é Coisa Boa verschaffte, die in diesem Konzertsaal präsentiert wurde. Es war ein ungewöhnliches Debüt. Es genügt zu sagen, dass Teresa, zusammen mit Rogério Paulo, im selben Jahr von den Kritikern zum Durchbruch gekürt wurde. Doch anstatt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, suchte die rastlose Schauspielerin sofort nach neuen Horizonten. Sie wollte weiterkommen. Sie wollte eine internationale künstlerische Ausbildung. Und sie ging nach Brasilien“, so die damalige Presse.
Es sind nur wenige Porträts von ihm bekannt, aber eines davon stammt aus dieser Zeit und stammt von dem portugiesisch-brasilianischen Fotografen Fernando Lemos (1926–2019). Das Foto gehört zur Sammlung des Modern Art Center (CAM) der Gulbenkian Foundation und der Berardo Collection. Es ist auch im Buch „Portraits of Whom?“ enthalten. „Fotografia Portugal anos 50“ von Fernando Lemos, herausgegeben vom Instituto Camões im Jahr 2000, enthält Fotografien des in Portugal geborenen, aber seit 1953 in Brasilien ansässigen Fotografen, bildenden Künstlers und Grafikdesigners. Neben Porträts von Sophia de Mello Breyner Andresen, Maria Helena Vieira da Silva und Mário Cesariny ist sie hier: Tereza Torga (sic). Sie wird wie folgt beschrieben: „Schauspielerin und Revuetänzerin, sie tritt in dem Stück Lisboa É Coisa Boa auf, das im Coliseu dos Recreios aufgeführt wird, in einem musikalischen Duett mit dem Schauspieler José Viana.“

▲ „Teresa Corista“ ist der Titel der Fotografie von Fernando Lemos aus den Jahren 1949-52, die zur CAM Collection – Gulbenkian Modern Art Centre gehört
© Fernando Lemos
Zu dieser Zeit war Maria Teresa bereits mit einem Mann namens David Ribeiro verheiratet. Da weder Datum noch Dauer der Eheschließung bekannt sind, gibt sich die Künstlerin in der Lizenz für öffentliche Auftritte, die am 4. Juli 1951 vom Nationalen Sekretariat für Information, Populärkultur und Tourismus ausgestellt wurde, unter ihrem Ehenamen Maria Teresa Gomes Batista Ribeiro. Der Künstlername Teresa Torga hatte sich noch nicht durchgesetzt. Auf der Berufskarte, für die er zweihundert Escudos bezahlt hat, wählt er: Maria Teresa.
Alles deutet auf eine Karriere mit Aufstieg hin. „Alle Kritiker sagten, sie sei wunderbar. Sie wurde sogar mit Eunice Muñoz verglichen“, sagt Filipe Lá Féria, ein bekannter Produzent und Regisseur, heute. Mit 80 Jahren sagte er, er habe sie vor dem 25. April auf der Bühne in einem „Stück von Eugene O’Neill“ gesehen. „Sie war eine Rebellin, eine Frau, die das Leben mit aller Kraft annahm“, sagte sie dem Observador. „Ich habe es auch oft nachts in der Bohème-Szene gesehen. Die Künstler trafen sich im Café Monumental, im Monumental-Theater selbst und in einem anderen Café in der Nähe, dem Monte Carlo“, erinnert er sich an die Räume, die bis spät in die Nacht von Schauspielern besucht wurden, insbesondere von denen, die mit dem Theater verbunden waren.
Doch Teresa Torga war mit der nationalen Aussicht nicht zufrieden und entschied sich, nach Brasilien zu gehen. „Nach ihrer Ankunft in Rio de Janeiro arbeitete sie an der Seite von Maria Dela Costa in einer Reihe von Fernsehshows. Sie sang die Revue Tem Candango no Soçaite mit Aniiza Lione und Costinha im Saal Rival“, heißt es in der Zeitschrift Plateia, einer ehemaligen Wochenzeitschrift für Shows.

▲ Teresa Torga (Bild links) in der Ausgabe der brasilianischen Zeitung Diario Carioca vom 9. Februar 1960
Im Jahr 1960 gelangte sein Name offiziell in die brasilianische Presse. Sie konkurriert um den Titel „Königin der Stars“, einem von Diário Carioca gesponserten Wettbewerb, bei dem die Königin unter den „berühmtesten Schönheiten in Theater-, Nachtclub- und Fernsehshow-Besetzungen“ gewählt wird. In der Ausgabe dieser Zeitung vom 9. Februar ist sie in einem gestreiften Hemd und mit erhobenen Armen neben zwei Rivalinnen im Wettbewerb zu sehen.
Es wird nicht lange dauern, bis Sie Seiten in Ihrem eigenen Namen erobert haben. „Nun, wenn sie schön ist, dann ja. Diese schöne Künstlerin möchte in Brasilien bleiben. Lasst sie bleiben“, las man im selben Jahr in der brasilianischen Zeitschrift Revista do Rádio neben zwei Fotos der Künstlerin.
Der Artikel soll ihr die Gegend um Vera Cruz näherbringen. Er erzählt, wie Dercy Gonçalves, eine Ikone des brasilianischen Theaters und Kinos, die junge Portugiesin davon überzeugte, den Atlantik zu überqueren, nachdem er mit ihr im Teatro Maria Vitória in Lissabon aufgetreten war. Gonçalves „war beeindruckt von einer jungen Schauspielerin namens Maria Teresa, die eine Offenbarung auf der portugiesischen Bühne war“.
Derci sprach mit der jungen Schauspielerin immer über Brasilien und sagte, dass sie Erfolg haben würde, wenn sie in die Fußstapfen von Beatriz Costa treten würde. Maria Teresa hingegen hielt es für zu früh: Sie wollte sich in Portugal einen Namen machen, in ihrem ersten Film („ As Minas de São Francisco “) mitspielen und ihre Gesangskünste verbessern. 1956, nachdem sie im portugiesischen Radio zur größten Entdeckung gekürt und vom Programm „Voz de Portugal“ engagiert worden war und in Nachtclubs in Madrid und Barcelona auftrat – was ihre erste Auslandstournee werden sollte –, nahm sie den Namen Teresa Torga an.
Dieselbe Zeitung erklärt, dass es Maestro Guio de Morais war, der „von den Qualitäten der portugiesischen Entdeckung“ begeistert war und „seinen Erfolg in Brasilien voraussah“, und ihm einen Zweijahresvertrag für Aufnahmen bei Tiger anbot. „Er begann mit einer Saison in Manaus und Belém, wo er im Radio und in Nachtclubs auftrat“, schreibt Revista do Rádio . 1960 nahm sie in Rio de Janeiro ihr erstes Album auf, das einige Zeilen in der Albumsektion des Magazins verdient: „Tereza Torga hat Fado das Caldas und Fado da Saudades auf Tiger aufgenommen, begleitet von den portugiesischen Gitarristen Ferreira und Rodrigues. Es ist eine 78-U/min-Platte.“
Das Theater schien außen vor zu sein. Im selben Jahr hieß es in einem Artikel der brasilianischen Presse: „Der Star will jetzt nur noch singen.“ Teresa Torga, ein Radio-, Nachtclub- und Plattenstar, widmet sich derzeit ganz ihrer Gesangskarriere. Sie hat sogar ein Sponsoring eines Erfrischungsgetränkeherstellers für einen Fernsehauftritt. Brasilien gefällt ihr in jeder Hinsicht und sie wird das Land nur verlassen, um in Venezuela zu singen, wohin sie immer wieder eingeladen wird. Sie wird aber bald zurückkehren, denn Brasilien ist für sie bereits ihre zweite Heimat. Am 27. Juni 1961 wurde sie beim brasilianischen Musikerorden unter der Nummer 4474 registriert. Teresa Torga trat als Sängerin auf und ihre Haupttätigkeit lag im Bundesstaat Guanabara.
„Es ist ganz sicher die schöne Portugiesin, die nach Brasilien kam und vor allem in São Paulo, im Lisboa Antiga , Erfolg hat. Teresa hat eine Platte bei Tiger herausgebracht und wird neben ihrer Fernsehkarriere bald eine LP bei der Plattenfabrik Chantecler herausbringen“, lesen wir 1961 in der Revista do Rádio .
Von dieser angekündigten Aufnahme stammt eine CD mit zwei von Teresa Torga gesungenen Liedern: De Degrau em degrau , eine Ballade von Jerónimo Bragança und Nóbrega e Souza, und Rua Sem Luz , ein Fado von António José Lampreia und Nóbrega e Sousa, der 1959 ursprünglich für die Stimme von Maria de Fátima Bravo komponiert wurde. Das Kulturzentrum von São Paulo bestätigt die Existenz dieser Platte, die 1962 beim Label Chantecler veröffentlicht wurde – einem Verlag, der 1972 verkauft und später in Warner Music (WEA) integriert wurde.

▲ 1962 in Brasilien unter dem Label Chantecler veröffentlichte Schallplatte mit zwei Liedern: „Rua Sem Luz“ und „De Degrau em Degrau“
Der Sammlungsleiter des Kulturzentrums von São Paulo, der für die Aufbewahrung und Erhaltung dieses Materials (der Sammlung der Discoteca Oneyda Alvarenga) verantwortlich ist, hat Observador ein Bild der Schallplatte zur Verfügung gestellt, auf dem zu sehen ist, dass auf Seite A der Platte das Lied „De Degrau em degrau“ und auf Seite B „Rua Sem Luz“ zu hören ist. Beide Lieder werden von Tereza Torga (in dieser Schreibweise, mit „z“) mit dem Chantecler Orchestra aufgeführt.
Das Zentrum gibt an, dass es aufgrund brasilianischer Gesetze nicht in der Lage sei, die Audiodateien bereitzustellen, da es im Fall des Sängers und der Komponisten nicht über die Urheberrechte verfüge. Doch Alan Romero, ein Journalist und Musikforscher aus Rio de Janeiro, der heute in Lissabon lebt, konnte eine Kopie der Schallplatte ergattern. Sein Interesse an dem Thema wurde geweckt, nachdem er einen portugiesischen Blog namens „Rua dos dias que voam“ gelesen hatte, der ein Interview mit Teresa Torga in der inzwischen eingestellten Zeitschrift Plateia veröffentlicht hatte. Die Portugiesin sagte, sie habe von 1952 bis 1963 in Rio de Janeiro gelebt und mit Maria Della Costa, Costinha und anderen großen Namen im Theater, auf der Bühne und im Fernsehen zusammengearbeitet. Was die Aufmerksamkeit der 73-Jährigen aus Rio erregte, war der Hinweis auf ein Album, das sie aufgenommen hatte.
„Ich habe das ganze Internet durchsucht, bis ich diese Rarität in der Sammlung der Discoteca Oneyda Alvarenga fand! Es handelt sich um eine Ausgabe des Chantecler-Labels aus dem Jahr 1962, vielleicht das einzige noch existierende Exemplar, das dank dieser Institution erhalten geblieben ist“, schrieb er 2011 in einem Text auf der Website des Centro Cultural São Paulo (heute nicht mehr verfügbar), in dem er prahlte, dass „Teresa Torga langsam“ „aus dem Nebel der Vergessenheit auftauchte“.
Die Lieder, die sie dieser Zeitung vorstellt, offenbaren die Stimme der Fado-Sängerin. „Straße ohne Licht und ohne Farbe, Steine der Sünde und der Liebe, treu und nackt, Straße ohne Mond, Straße ohne Wert“ , hören wir.
„Schritt für Schritt“, von Jerónimo Bragança und Nóbrega e Souza
„Straße ohne Licht“, von António José und Nóbrega e Sousa
„Sie hatte in Brasilien einigen Erfolg, war eine schöne Frau und erregte Aufmerksamkeit. Sie hätte dort bleiben können, aber die Krankheit ihrer Mutter zwang sie zur Rückkehr“, sagt die 75-jährige Maria Jorgete Teixeira, die sich ebenfalls mit der mysteriösen Teresa Torga beschäftigte und 2017 beschloss, „Mulher à beira de uma soltada de pombos“ zu schreiben, basierend auf den Liedern von José Afonso (Alfarroba), einem Buch mit fiktiven Geschichten, die auf den Liedern der Singer-Songwriterin basieren.
Teresa Torga kehrte 1963 aus Brasilien zurück, heißt es in einem Artikel im Magazin Plateia . Lissabon erschien ihr nun anders. Alles hatte sich verändert, sogar das künstlerische Umfeld. Ihr seelischer Zustand, bedingt durch den Schmerz über den Verlust ihres geliebten Menschen, hielt sie von der Bühne fern. Schließlich beschloss sie, sich im Casino Estoril als Sängerin zu versuchen. Es war ein unbestreitbarer Erfolg. Diese erste Gelegenheit gab ihr Mut. Die Theaterunternehmer drangsalierten sie damals. Sie lehnte systematisch ab. Sie nahm eine weitere Einladung an, acht Tage lang an der Seite von Torre Bruno im Casino de Gibraltar aufzutreten. Anschließend ging sie nach Madeira, um den Nachtclub im Hotel Santa Maria zu eröffnen. Und schließlich, nachdem sie im Sommer letzten Jahres in mehreren Casinos der Metropole aufgetreten war, beschloss sie, sich der Besetzung des Teatro Variedades anzuschließen.
1965 schloss er sich der Besetzung der Zeitschrift A Ponte a Pé an, die neben Humberto Madeira und Mariema von den Geschäftsleuten Vasco Morgado und Giuseppe Bastos produziert wurde.
Im folgenden Jahr 1966 berichtete die Zeitschrift Plateia über seine erfolgreiche Rückkehr auf die portugiesische Bühne. „Die Zeitschrift A Ponte a Pé hat, neben anderen Sensationsgründen, einen Namen der Öffentlichkeit bekannt gemacht, der seit etwa 10 Jahren von den Bühnen unseres Unterhaltungstheaters verschwunden war“, heißt es darin. „Ihre Rückkehr ließ die Kritiker nicht kalt. Sie begrüßten sie begeistert und verglichen sie mit dem ‚hübschen Mädchen‘, das Brasilien sieben Jahre lang in seinen Armen hielt. Sie lobten sie in den höchsten Tönen und sagten, sie sei künstlerischer und selbstbewusster zurückgekehrt“, heißt es im selben Text weiter.
Später widmete ihr die Zeitschrift eine ganze Seite: Teresa Torga: die Offenbarung einer Erfahrung . Es erzählt, wie die Künstlerin zwei Filme geplant hatte – einer davon basierte auf dem Roman „As Minas de S. Francisco“ von Fernando Namora –, aber keiner von beiden zustande kam, wie sie nach Brasilien gegangen war und was sie dazu bewogen hatte, zurückzukehren.
Enttäuscht – sie hatte bereits für Zeitschriften gearbeitet und war sehr erfolgreich – reiste Teresa Torga nach Brasilien, wo sie mit offenen Armen empfangen und der Schauspielerin, die den Titel „Offenbarung des Jahres 1952“ gewonnen hatte, applaudiert wurde. Zur gleichen Zeit wie Rogério Paulo gab es weder für die Presse noch für das Fernsehen Oscars, noch sonst etwas. Plötzlich und aufgrund des tragischen Todes ihrer Mutter kehrte Teresa Torga nach Portugal zurück und blieb dort.“
Sie werde nicht so bald nach Brasilien zurückkehren, schrieb das Magazin, „obwohl sie dort noch immer ein Haus in São Paulo habe, wo sie eine große Anzahl von Katzen und Papageien habe, denn Teresa Torga liebe Tiere, die ihrer Meinung nach viel sanftmütiger und weniger undankbar als Menschen seien“.
In jüngster Zeit sei er als Sänger und Schauspieler beim „ABC, im Casino Estoril, im Casino de Espinho und auf vielen anderen Bühnen“ aufgetreten, schreibt Óscar Alves in dem Plateia -Artikel. Auf Einladung von Giuseppe Bastos und Vasco Morgado für die Zeitschrift A Fonte a pé kehrte sie auf die Musiktheaterbühne zurück, obwohl ihre Arbeit ihrer Kategorie nicht würdig war. Aber es ist die Schauspielerin selbst, die uns sagt: „Man muss seinen Lebensunterhalt verdienen, und dann akzeptiert man alles.“
Sie tat Dinge, die man nicht erwartete. Sie war eine Frau, die sich völlig im Griff hatte. Irgendwann fand sie keine Arbeit mehr, also packte sie ihre Koffer und ging nach Brasilien. Nur wenige Frauen taten das damals. Sie war ihrer Zeit voraus.
Helder Freire Costa, Regisseur von Maria Vitoria
Hélder Freire Costa, der Verantwortliche von Maria Vitória, erinnert sich genau an Teresa aus dieser Zeit, Ende der 60er Jahre, als er Sekretär bei der Partnerschaftsfirma von Giuseppe Bastos und Vasco Morgado war, die im Teatro Variedades im Parque Mayer ansässig war.
„Ich habe sie nur bei einer Show gesehen“, erinnert er sich gegenüber Observador . „Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber es war eine portugiesisch-brasilianische Kompanie, und sie war Teil der Besetzung. Sie war damals schon ziemlich bekannt“, bemerkt er. „Ich glaube nicht, dass sie ihre Aufgabe bis zum Schluss erfüllt hat“, sagt er.
Der Besitzer von Maria Vitória beschreibt sie als „eine wunderschöne Schauspielerin“, aber auch als „eine Frau voller Leben“ mit einer „sehr starken Persönlichkeit“. Was würde das in einem grauen Portugal mitten im Estado Novo bedeuten? Sie war mit ihren Freunden befreundet, aber sie war eine kontroverse Person. Sie hatte ihre eigenen Ideen. Sie hielt sich nicht zurück. Sie war eine freie Frau, eine Frau des Kampfes. Damals waren Frauen eher zurückhaltend. Sie war nie so, sie verstand, dass Frauen damals genauso viele Rechte hatten wie Männer.


▲ In den 1960er Jahren wurde Teresa Torga in der nationalen Presse am häufigsten erwähnt. Im Jahr 1966 wurde sie in der Theaterzeitschrift Plateia als eine der „wenigen prominenten Persönlichkeiten im portugiesischen Varieté“ beschrieben.
Sie tat Dinge, die man nicht erwartete. Sie war eine Frau, die sich völlig im Griff hatte. Irgendwann fand sie keine Arbeit mehr, also packte sie ihre Koffer und ging nach Brasilien. Nur wenige Frauen taten das damals. Sie war ihrer Zeit voraus.
Im Jahr 1969, nach Jahren der Abwesenheit vom Plateau , tauchte er in der Zeitschrift Plateia in einem Interview wieder auf, in dem er seinen „Rückzug von der Revuebühne“ rechtfertigte. „Teresa Torga ist eine temperamentvolle Frau und kämpft weiterhin, wie schon vor Jahren, um den Platz zu erobern, den sie ihrer Meinung nach verdient“, heißt es in den Zeilen vor dem Interview in Plateia (8. Juli).
Ich begann wie einige der Künstler, die heute herausragende Positionen in unserer Kunstwelt einnehmen, und vielleicht hatte ich – im Vergleich zu ihnen – den Nachteil, zu viel zu reden, weil ich mein Herz auf der Zunge trug. „Aber ich bereue nichts“, sagte sie. „Trotz allem bin ich nicht bereit, Kompromisse einzugehen oder meine Ideen und Konzepte aufzugeben.“
„Ich weiß, was ich wert bin“, sagte sie selbst. „Ich bin es gewohnt, mich den Schwierigkeiten zu stellen, die mir begegnen, und zu versuchen, sie zu umgehen. Ich habe keinen Platz im Theater? Ich trete in Nachtclubs auf. Was mich vor allem interessiert, ist, meinen Lebensunterhalt als Künstler zu verdienen, unabhängig davon, wo ich auftrete.“ Das dem Artikel beigefügte Foto zeigt ihn mit übereinandergeschlagenen Beinen und einem Glas in der Hand.

▲ In einem Interview mit der Zeitschrift Plateia (Ausgabe vom 18. Juli 1969) sprach Teresa Torga über ihren Abschied von der Revuebühne
Der Interviewer, Carvalho Ramos, beharrte darauf: Könnten es die „Probleme hinter den Kulissen“ gewesen sein, die „seine Stabilisierung als Zeitschriftenkünstler behindert“ hätten? Teresa Torga antwortete: „Nun ja … ich bin mir sicher, dass ich, wenn es nicht ab und zu Bedenken gäbe, dass sich hinter den Kulissen Probleme mit persönlichen vermischen, sicherlich häufiger in den Magazinen zu sehen wäre. Allerdings gebe ich ehrlich zu, dass mich die Tatsache, dass ich einige Zeit außerhalb Portugals verbracht habe, möglicherweise daran gehindert hat, auf der Agenda der Verantwortlichen zu bleiben.“ „Ich war eine Zeit lang in Rhodesien und die Leute haben mich so sehr vergessen, dass sie sich selbst jetzt, nachdem ich schon seit Monaten hier bin, immer noch nicht an mich erinnern.“ Irgendwann zwischen 1968 und 1969 kehrte er nach Portugal zurück.
„Man kann sehen, wie schön sie war“, sagt Maria Jorgete Teixeira, während sie sich die Fotos ansieht, die sie gesammelt hat. „Ich habe versucht, alles über sie herauszufinden, über die Frau, die den Song inspiriert hat.“ [Nach ihrer Rückkehr nach Portugal] arbeitete sie noch immer für die Zeitschrift, doch die Symptome ihrer Depression begannen sich zu bemerkbar zu machen. Die Krankheit verschlimmerte sich… Sie gab die Schauspielerei schließlich auf, und später folgte ihr Júlio de Matos. Dieser Vorfall ereignete sich am 6. Mai 1975. Sie zog sich auf der Straße aus, der Fotograf versuchte, sie zu fotografieren, und die Leute wurden wütend.


▲ Maria Jorgete Teixeira, 65 Jahre alt, wurde von Teresa Torga inspiriert, eine der Kurzgeschichten im Buch „Frau am Rande einer Taubenfreilassung – Rund um die Lieder von José Afonso“ (Alfarroba, 2017) zu schreiben.
FRANCISCO ROMÃO PEREIRA/BEOBACHTER
In der fiktiven Version der berühmten Episode schreibt Maria Jorgete über „ein Feuer, eine gewaltige Flamme, ein Feuer, das aus der Mitte des Körpers einer Frau kommt“. „Der Bürgersteig gewinnt Augen ungezügelter Völlerei, Pupillen, die an den Schenkeln haften, Hände, die sich bis zum Gesäß strecken, Handschuhe in den gesättigten Sechsecken und ein Gesicht, das sich auflöst und die Nacht ewiger Einsamkeit von innen her mit sich bringt. Die Leute rennen, die Leute schreien, während manche es mit ihren Augen enthüllen, andere versuchen, es zu bedecken, lass es sich anziehen, lass es sich anziehen, doch diese Seele, die das Fleisch so sehr misshandelt, ist aus Feuer“, schreibt Teresa Torga in der Kurzgeschichte, die in Mulher à beira de uma partirda de pombos, volta das canções de José Afonso (Alfarroba, 2017) erscheint.
„António Capelas professionelles Auge erkennt in einer ungewöhnlichen Szene einen sinnvollen Moment, rahmt die Szene ein und feuert einen Blitz nach dem anderen ab. Die Leute werden wütend, greifen ihn an und wollen seine Kamera zerstören“, schreibt er. „Die Rolle wird von wütenden Füßen zertrampelt, wo hast du das je gesehen? Den Wahnsinn einer Frau so auszunutzen, das arme Ding, entsprach nicht seinem vollen Urteilsvermögen.“
Die Episode ist nicht friedlich, wenn es um die Absichten von António Capela (1927–1996) geht, einem historischen portugiesischen Fotojournalisten, dessen berufliche Tätigkeit sich hauptsächlich auf den Bereich Sport konzentrierte. Auch die österreichische Forscherin Elfriede Engelmayer, die sich an der Universität mit José Afonsos Lyrik beschäftigt hat, schreibt darüber, dass sie „vom Volk solidarisch vor der Sensationslinse der Fotoreportage von António Capela geschützt wird“, wie Mário Correia in dem Buch As mulheres cantadas por José Afonso zitiert.
Doch auch wenn es Zweifel am Verhalten des Fotojournalisten gibt, gibt es keine hinsichtlich dessen, was auf den Vorfall folgte: absolutes Schweigen. „Von da an verschwindet sie“, sagt Jorgete.
In der Kolumne von Rogério Rodrigues – einem Journalisten und Vater des 2019 verstorbenen Regisseurs Tiago Rodrigues – schreibt er, dass Teresa „bereits zweimal ins Júlio de Matos eingeliefert wurde und für eine weitere 15-tägige Behandlung zurückkehren wird, weil sie mit einigen Freunden zu Mittag gegessen hat, sie ausgegangen sind, sie sich zu Hause allein gefühlt hat und dann auf die Straße gegangen ist, um Leute zu treffen und sich auszuziehen.“ In den vom Observador gesammelten Zeugenaussagen ist dies nicht das einzige Mal, dass auf die Möglichkeit hingewiesen wird, dass Teresa Torga in die psychiatrische Klinik Júlio de Matos eingewiesen worden sei. Observador kontaktierte die Pressestelle der örtlichen Gesundheitseinheit São José in Lissabon, die seit 2024 zum Krankenhaus Júlio de Matos gehört, konnte jedoch nicht bestätigen, ob der Patient in die Einrichtung eingeliefert wurde.
Nach der Episode, in der dies gefeiert wurde, gibt es kaum noch Aufzeichnungen. „Um zu überleben, vermietete sie drei Zimmer in ihrem Haus und ihr letzter Job war das Auflegen von Schallplatten in einem Nachtclub in Benfica“, schreibt Mário Correia in dem Buch As mulheres cantadas por José Afonso (2013, Sons da Terra Editions), in dem sie ein kurzes Porträt von Teresa Torga zeichnet.
Seine letzte bekannte Adresse ist der vierte Stock der Avenida Elias Garcia Nr. 132 in Lissabon. Den heutigen Bewohnern dieser Straße sagt der Name nicht viel, doch in der Pastelaria Milú, die es seit mehreren Jahrzehnten gibt, gibt es noch immer Menschen, die sich an ihn erinnern. „Ich erinnere mich gut, ich habe hier unten gelebt“, sagt der 60-jährige António Pereira, der mindestens 35 Jahre in dem Haus gearbeitet hat, das früher eine Kuchenfabrik war. „Früher habe ich hier gefrühstückt. Ich sagte immer, ich sei ein Künstler“, erinnert sich der Arbeiter, der noch immer seinen Minho-Akzent schätzt. Als Mann weniger Worte sagt er mitten im Gottesdienst auch: „Ich glaube, eine Dame wohnte mit ihr in einem Zimmer, das sie dort hatte.“
Wir haben nachgefragt, wie es im Deal war. „Ich hatte alles“, lacht er. „Sie war freundlich und konnte mürrisch sein, wenn Leute sie belästigten, aber sie war ein guter Mensch.“ Von dem Gebäude, in dem er lebte, sei nur noch ein Teil der Fassade erhalten, betont er. „Das Gebäude ist eingestürzt. Vor etwa zehn Jahren waren einige Studenten dort und dann kam es zu einem Erdrutsch, bei dem alles herunterfiel“, erklärt er. António Pereira kann sich nicht erinnern, wann er sie das letzte Mal gesehen hat. „Sie hatte einen Zusammenbruch oder so etwas und ging ins Krankenhaus und hat nie wieder von ihr gehört.“
Teresa Torga wurde 2001 Mitglied der Casa do Artista. Sie war 68 Jahre alt und hatte eine zittrige Unterschrift, wie aus dem von Observador eingesehenen Registrierungsformular hervorgeht. Beruf? Varietekünstler. Er hat keine bekannten Kinder oder Verwandten.

▲ Unterschrift von Maria Teresa Gomes Baptista auf dem Anmeldeformular der Künstlerhilfsvereinigung (Casa do Artista), 2001
„Es hatte einen triumphalen Auftritt, aber dann löste es sich auf“, beklagt Filipe Lá Féria. „Ich fand ihr Ende etwas traurig, aber ich habe es vergessen.“ Hélder Freire Costa erinnert sich, dass sie „Freunde im Coliseu“ hatte, er sie aber irgendwann aus den Augen verlor. Vor einigen Jahren erinnerte sich jemand: „Was ist mit Teresa Torga passiert?“, hörte er in einem Gespräch. „Ich fragte mich, ob sie noch lebte, aber dann sagte mir jemand, sie sei gestorben.“
Teresa Torga starb am 8. April 2007 in Lissabon. Er war 74 Jahre alt, wie die Sterbeurkunde bestätigt. Sie ist auf dem Friedhof von Olivais begraben.
Als José Afonso 1976 „Com as minhas tamanquinhas“ und dazu das Lied „Teresa Torga“ veröffentlichte, war das Album kein Erfolg. Dass das Album nach dem 25. April aufgenommen wurde, ist kein Einzelfall: Die ausführlichen Texte der vorherigen Alben wurden zugunsten einer engagierteren Stimme geopfert, wobei Denunziation und Intervention Vorrang vor der Subtilität verschleierter Kritik haben – das einzig Mögliche in einer Diktatur. Das Album sei „von der rechten Presse als das schlechteste des Jahres eingestuft worden“, „eine Einschätzung, die meiner Meinung nach rein politischer Natur ist“, warf der Sänger zwei Jahre später in einem Interview mit Diário de Lisboa am 25. Februar 1978 vor. Und er fügte hinzu: „Meiner Meinung nach gehören die Lieder auf diesem Album, Alípio de Freitas und Teresa Torga, zu den besten, die ich je geschrieben habe.“
Sie ist eine Frau, die existierte, die ein Lied hervorbrachte, das zum Symbol der weiblichen Emanzipation wurde. Eine der Strophen ist ein Slogan, und diese Frau scheint keinerlei Bedeutung zu haben. Das Lied wird zum Symbol, der Name Teresa Torga auch, aber es ist merkwürdig, dass niemand diese Frau kennt.
Maria Jorgete Teixeira, Autorin und Co-Direktorin der José Afonso Association
José Afonso ging immer davon aus, dass Teresa Torga „aus einem fait-divers aus dem Diário de Lisboa“ entstanden sei, und zwar „der Geschichte einer Frau, die sich am Rossio auszog“. Dem Sänger sei es darum gegangen, „die Sensationsgier in der Fotografie anzuprangern“, sagt er in dem oben zitierten Interview, aber „das Interessanteste“, betont er, sei „die Tatsache gewesen, dass die Leute die Frau mit Kleidung bedeckten, während sie sich gegen den Fotografen wandte“. Diese Frau, ein Star in Vasco Morgados Shows, eine Frau in ihren Vierzigern, wurde auf den Müll geworfen. Sie zog sich aus, als ob die kaufmännische Gesellschaft es von ihr verlangte. Die Episode ist bemerkenswert, denn sie zeigt, dass der 25. April auch einen Mentalitätswandel mit sich brachte. In einem sexistischen Land wie unserem vollführten die Menschen eine revolutionäre Geste…
Das Lied ist keineswegs eines der bekanntesten des sogenannten Sängers der Revolution, sondern vielmehr zu einem Symbol geworden. Es ist nicht ungewöhnlich, einen ihrer Verse auf Plakaten bei der Parade auf der Avenida da Liberdade am 25. April zu sehen: „Frauen in der Demokratie sind keine Wohnzimmerbildschirme.“

▲ Eine Frau hält während der Parade auf der Avenida da Liberdade am 25. April 2023 ein Schild mit dem Text des Liedes „Teresa Torga“.
TOMAS SILVA/OBSERVER
„Es ist eine Frau, die existiert hat, die ein Lied hervorgebracht hat, das zum Symbol der weiblichen Emanzipation wurde, eine der Strophen ist ein Slogan, und diese Frau scheint überhaupt keine Bedeutung zu haben“, wirft Maria Jorgete Texeira vor und unterstreicht die Ironie.
Der brasilianische Journalist Alan Romero, der seit 1986 in Lissabon lebt und schon lange von der Figur Teresa Torga fasziniert ist, macht eine ähnliche Beobachtung: „Es störte mich sehr, eine so unbekannte Frau zu sein, dass die Leute dachten, sie sei eine Fiktion.“
Während der Vers Widerstand leistet, werden der Inhalt und die wahre Geschichte, die ihn hervorgebracht hat, außer Acht gelassen. Es ist ein Schweigen, das 50 Jahre lang gedauert hat – und das erst jetzt in Frage gestellt wird. Anfang des Jahres erlangte ihr Gesicht Bekanntheit, als es als Werbematerial für das Theaterstück „ Kein Joghurt für die Toten “ von Tiago Rodrigues verwendet wurde, dem Regisseur und Sohn des Journalisten, der Teresa Torga der Welt bekannt machte. In dem Stück, das die letzten Tage von Rogério Rodrigues 'Leben darstellt, las die Schauspielerin Beatriz Brás die Diário de Lisboa Chronicle, während Manuela Azevedo Sang Teresa Torga in einer Version für eine Show von Hélder Gonçalves, die von sich aus live gespielt wurde.
"Das Lied wird zum Symbol, der Name Teresa Torga, aber es ist merkwürdig, dass niemand diese Frau kennt", sagt Jorgge Teixeira. Eine „unabhängige, unabhängige, autonome Frau, die ihr Leben regiert, die Künstlerin ist, die allein die Regeln der gegenwärtigen Moral brechen würde. In diesem Aspekt ist sie dieses Symbol und diese Stärke“.
Der Gründer der José Afonso Association in Barreiro und auch Mitglied des Vorstands dieser Institution stellt fest, wie „es Forscher gibt, die sich bereits mit dem Lied befasst haben, aber es sind Analysen des Liedes und des Gedichts und nicht ihres Lebens“. 50 Jahre später sagt er: "Was bleibt das Lied und was es auferweckt hat." "Es ist, als ob das Leben dieser Frau überhaupt keine Rolle spielte."
observador