Die klinischen Leitlinien für ventrikuläre Arrhythmien wurden aktualisiert.
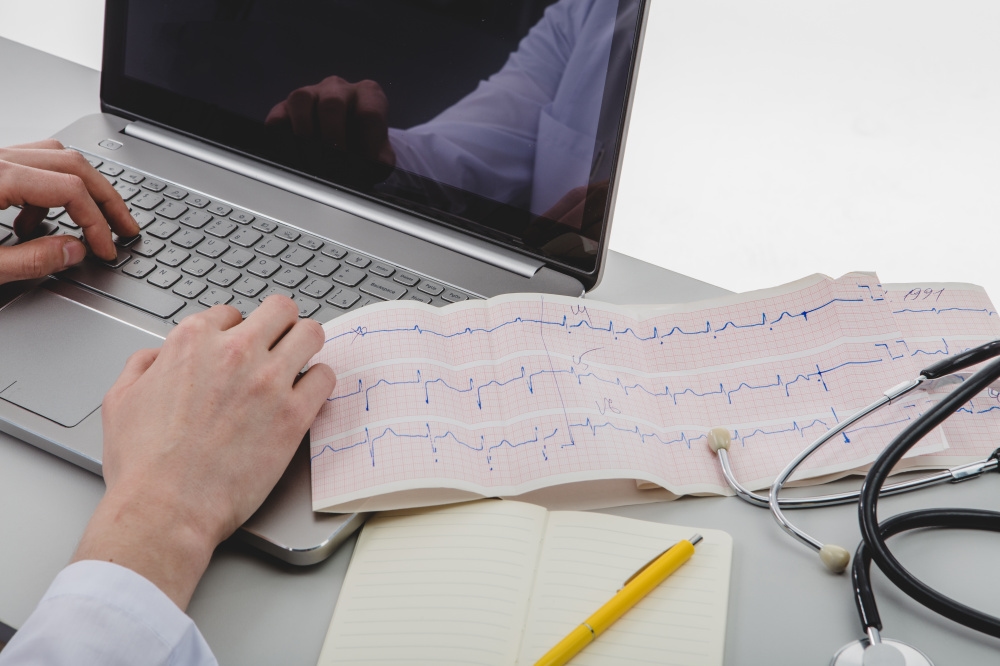
Ventrikuläre Arrhythmien sind definitionsgemäß ein Sammelbegriff für Herzrhythmusstörungen, bei denen die Quelle der ektopischen Aktivität bzw. des Reentry-Kreislaufs unterhalb des His-Bündels liegt.
Die aktualisierte Version der Leitlinien schlägt eine neue, erweiterte Klassifizierung ventrikulärer Arrhythmien (VA) vor, die im März 2023 genehmigt wurde. Ärzten wird empfohlen, die Arten der ventrikulären Arrhythmie, die Dauer und das Wiederauftreten der ventrikulären Tachykardie (VT), morphologische Merkmale des QRS-Komplexes, die Art der Grunderkrankung und die Symptome zu den wichtigsten Merkmalen zu zählen, die in die Diagnose einfließen.
Die Empfehlungen besagen nun, dass die wichtigsten Methoden zur Diagnose einer ventrikulären Dysfunktion das EKG und die Langzeitüberwachung des Elektrokardiogramms (HMECG) sind. In einigen Fällen wird jedoch eine intrakardiale elektrophysiologische Untersuchung (ICES) durchgeführt, um die Diagnose zu stellen und zu klären.
Im Abschnitt zur instrumentellen Diagnostik heißt es, dass der ICEFI nicht zur Stratifizierung des Risikos eines plötzlichen Herztods (SCD) bei erwachsenen Patienten mit Short-QT-Syndrom (SQTS) und katecholaminerger polymorpher ventrikulärer Tachykardie (CPVT) empfohlen wird.
Die Aufsichtsbehörde empfiehlt, dass sich im Rahmen der molekulargenetischen Untersuchung auf Mutationen in Genen, die nachweislich eine kausale Rolle im Zusammenhang mit dem Long-QT-Syndrom (LQTS) spielen, alle Patienten, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für die klinische Diagnose eines LQTS besteht, einem CMECG und einem Belastungstest unterziehen.
Das Gesundheitsministerium hat außerdem separate Unterabschnitte mit Empfehlungen zum Brugada-Syndrom, CPVT, QT und arrhythmogener Kardiomyopathie identifiziert. Beispielsweise wird beim Brugada-Syndrom ein Test auf Mutationen im SCN5A-Gen empfohlen.
Darüber hinaus werden Empfehlungen zur pathologischen Untersuchung und molekulargenetischen Analyse bei Opfern eines plötzlichen Herztodes dargelegt. Beispielsweise wird unabhängig vom Zeitpunkt der Autopsie empfohlen, neben der pathologischen Untersuchung auch eine elektronenmikroskopische Untersuchung des Myokardbiopsiematerials (chirurgisches Material) durchzuführen.
Darüber hinaus enthalten klinische Leitlinien mittlerweile eine Reihe diagnostischer Tests für bestimmte klinische Situationen. So werden beispielsweise für Patienten, die einen plötzlichen Herzstillstand überlebt haben, wiederholte 12-Kanal-EKG-Aufzeichnungen mit stabilem Rhythmus und kontinuierlichem EKG-Monitoring empfohlen.
Das Gesundheitsministerium hat außerdem eine Liste mit Empfehlungen für Wiederbelebungsmaßnahmen bei Herzstillstand erstellt. So empfiehlt das Ministerium beispielsweise bei einem plötzlichen Herzstillstand ausdrücklich eine elektrische Defibrillation. Sollte die Defibrillation wirkungslos bleiben, wird die intravenöse Gabe von Lidocain empfohlen. Die Leitlinien enthalten auch Empfehlungen zur Versorgung von Patienten mit besonderen Erkrankungen (Sarkoidose, Myokarditis, Lyme- und Chagas-Krankheit usw.), Patienten in besonderen Gruppen (z. B. während der Schwangerschaft oder nach einer Herztransplantation) und Kindern.
Herzrehabilitationsprogramme zielen darauf ab, die negativen physiologischen und psychologischen Auswirkungen von Herzerkrankungen zu begrenzen.
In Russland wurde als Teil des nationalen Projekts „Langes und aktives Leben“ ein gleichnamiges Bundesprojekt zur Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt. Seine Hauptziele, so die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa im Juli 2024, sind die Erhöhung des Anteils der Patienten mit Hirninfarkt, die sich einer Thromboseextraktion unterziehen, an allen aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten von 1,6 % auf 5 %; die Erhöhung der Zahl der Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die das Vorjahr ohne akute Gefäßereignisse überlebt haben, von 4 % auf 10 %; die Erhöhung des Anteils der Fälle von Thrombolysetherapie und Stenting bei Patienten mit Herzinfarkt an allen innerhalb der ersten 24 Stunden ins Krankenhaus eingelieferten Patienten von 82,2 % auf 95 %; und die Erhöhung des Anteils der Personen mit hohem Komplikationsrisiko oder nach Herzoperationen, die Medikamente erhalten, von 95 % auf 98 %.
Jedes Jahr stellt der Staat Mittel aus dem Bundeshaushalt bereit, um die Ziele nationaler und bundesweiter Projekte umzusetzen. Wie die Mittelverteilung im Jahr 2026 aussehen soll, wird im Vademecum beschrieben .
vademec





